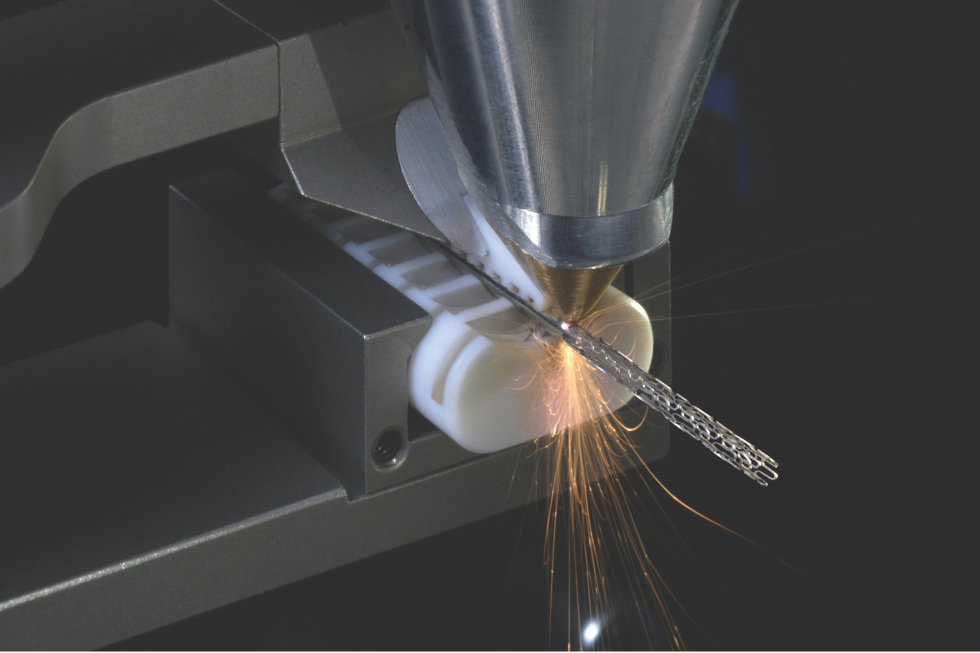Your best choice for sheet metal processing
-
Laser Cutting -
Laser Automation -
Press Brakes -
Bending Automation -
Tube Laser Cutting -
Software
Your best choice for Laser Cutting
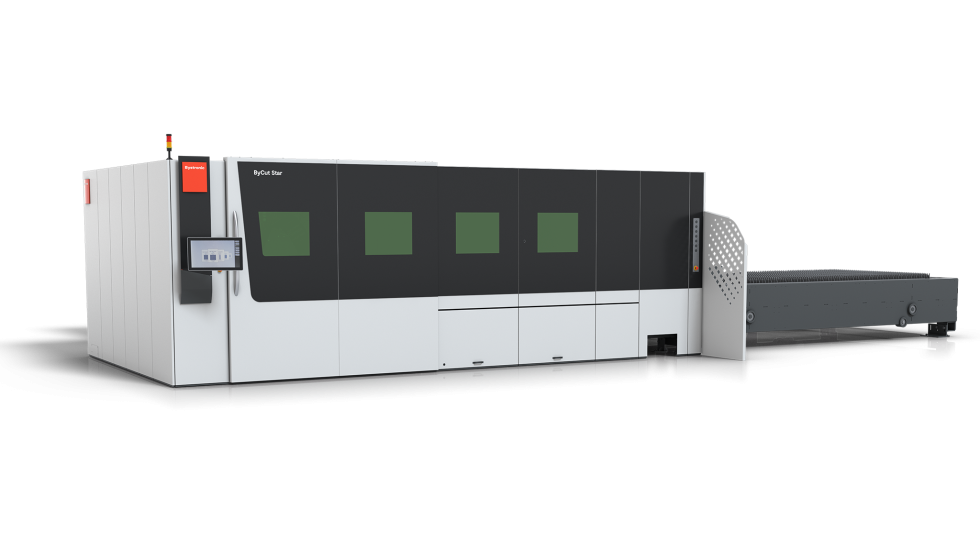
Fast, flexible, and precise: Smart machines for laser cutting
Your best choice for Laser Automation
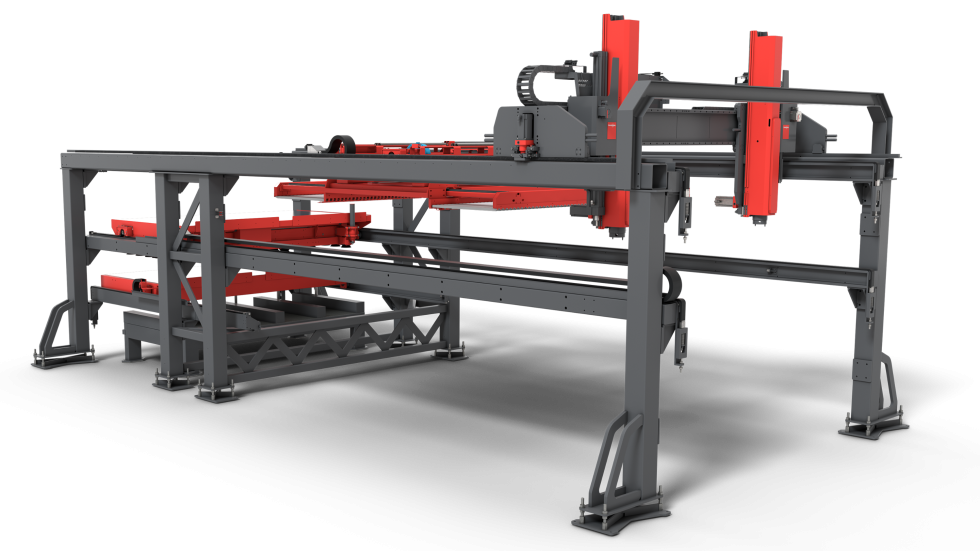
Productivity & efficiency: Optimize your laser cutting system with laser automation
Your best choice for Press Brakes

Smart, intuitively operable, and strong: Press brakes for any need
Your best choice for Bending Automation
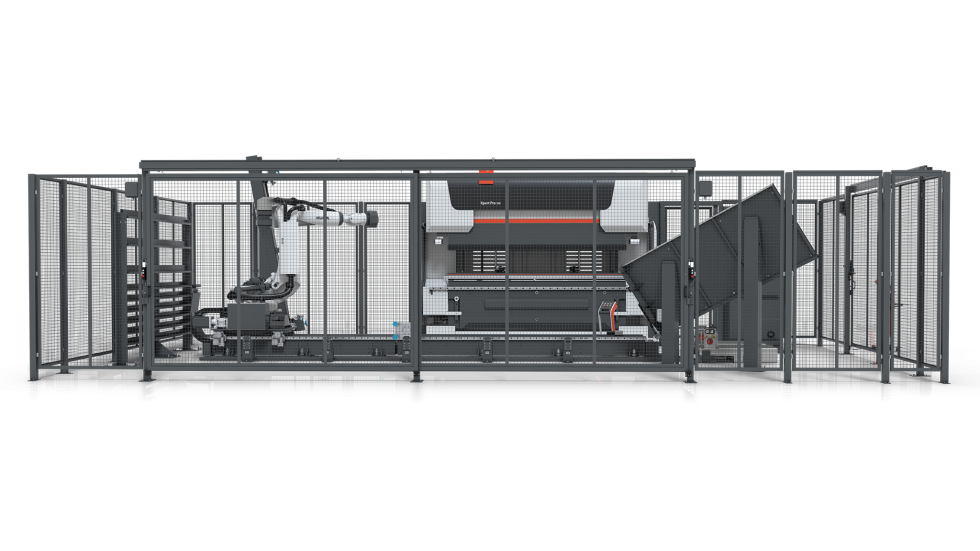
Productivity & efficiency: Optimize your press brakes
Your best choice for Tube Laser Cutting
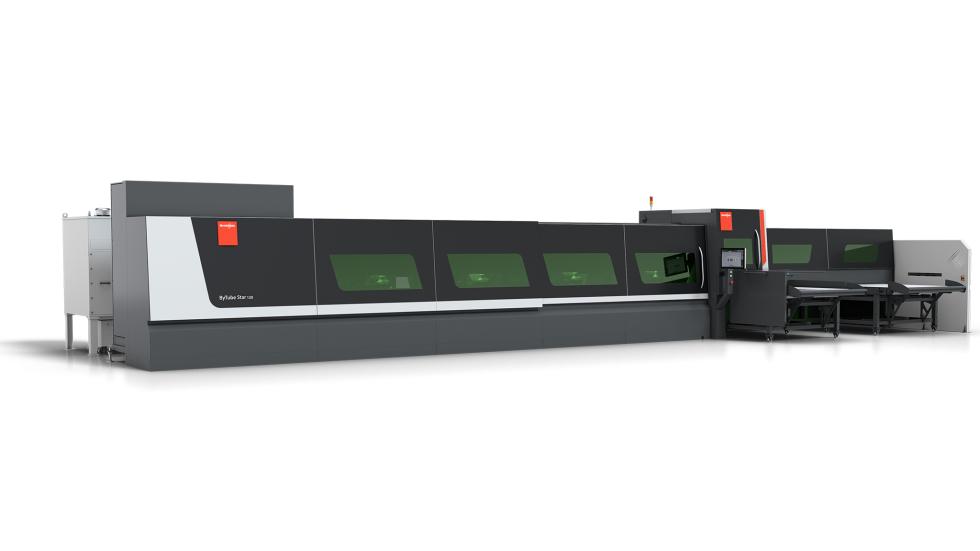
Flexible, powerful, and fast: More efficient cutting processes for greater profit
Your best choice for Software

The Software to enable the digitalization at sheet metal companies
Your best choice for Laser Cutting
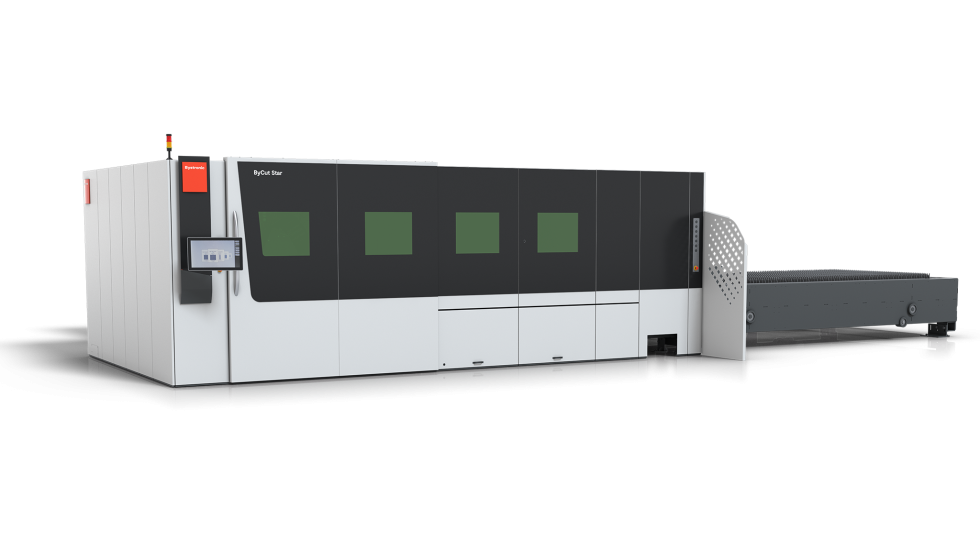
Fast, flexible, and precise: Smart machines for laser cutting
Your best choice for Laser Automation
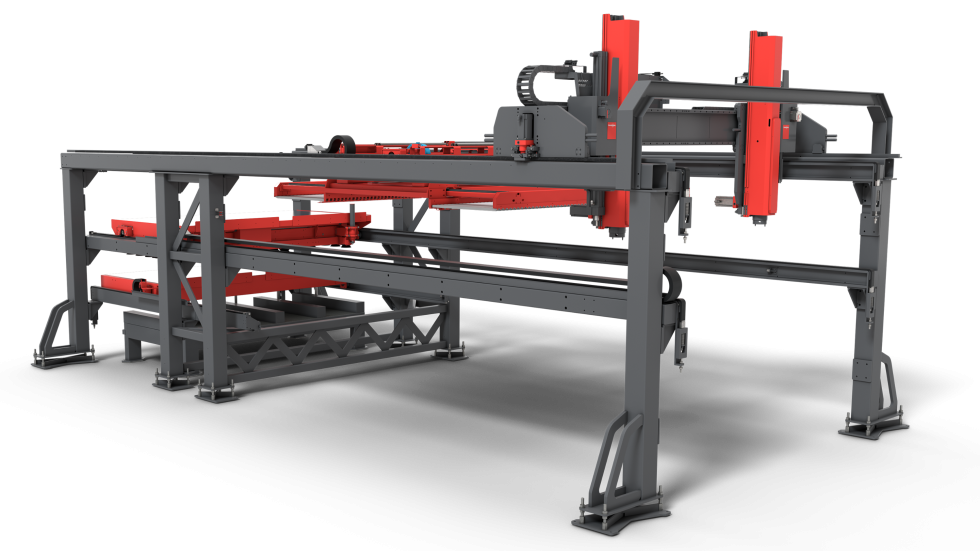
Productivity & efficiency: Optimize your laser cutting system with laser automation
Your best choice for Press Brakes

Smart, intuitively operable, and strong: Press brakes for any need
Your best choice for Bending Automation
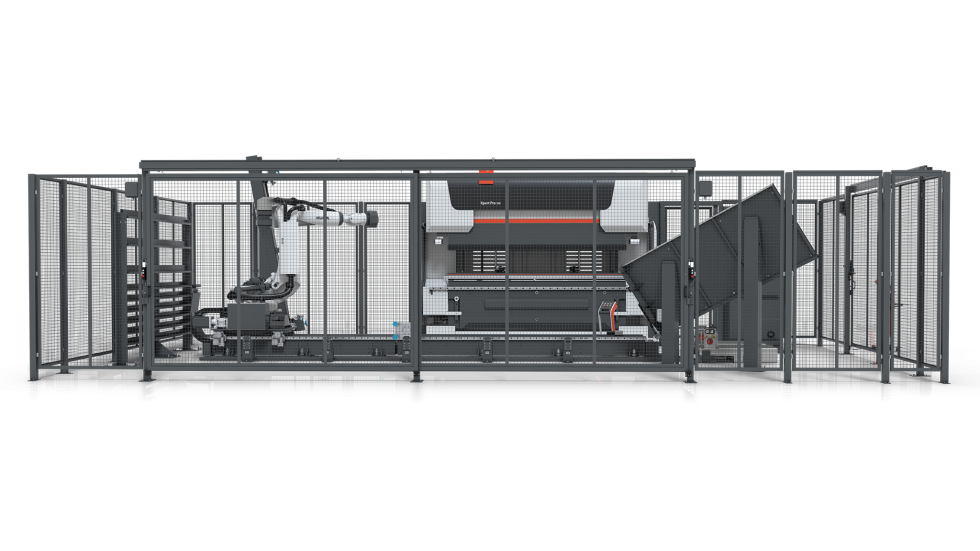
Productivity & efficiency: Optimize your press brakes
Your best choice for Tube Laser Cutting
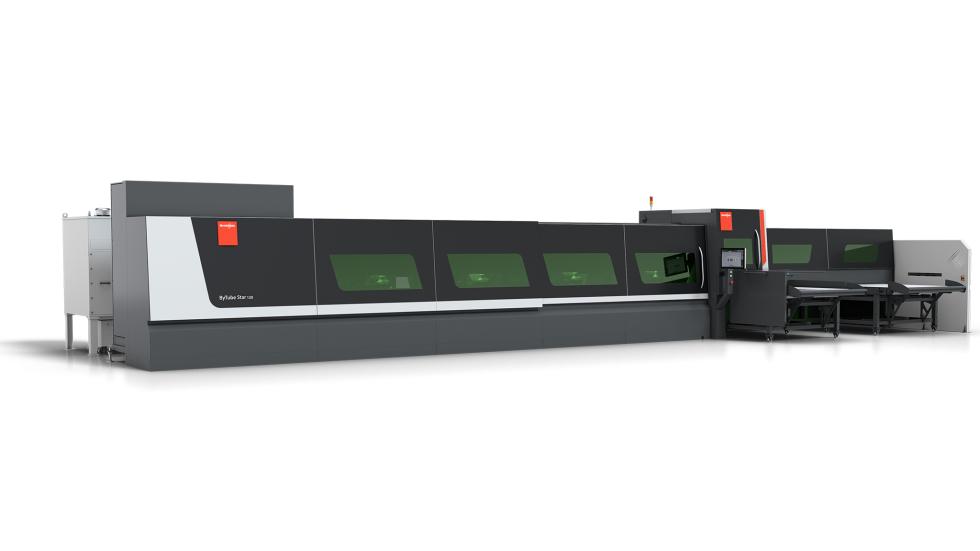
Flexible, powerful, and fast: More efficient cutting processes for greater profit
Your best choice for Software

The Software to enable the digitalization at sheet metal companies


Progress has tradition
From small craft business to high-tech sheet metal processor
Aussafer Due, an Italian family business, has grown from a small craft business to a high-tech sheet metal processing company. Its recipe: investment in advanced technologies. And a partnership with textile mogul Alessandro Benetton.
Working for Bystronic Would you like to become part of our team?
We live our company values:
- Innovation: We are constantly working on new solutions with added value for our customers.
- Openness: Here, everyone is involved, because we communicate openly with one another.
- Commitment: At Bystronic, we support each other.
Use Bystronic as your stepping stone into the international professional world. From training and internship to newcomers and professionals – Bystronic offers you the right environment for your career.

Your best choice for sheet metal processing of the future
At Bystronic, our specialists are happy to help you